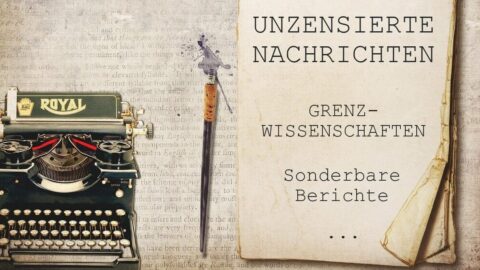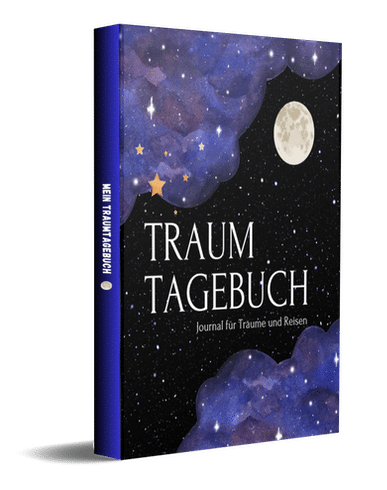Mystery Update: Die Straßburger Tanzwut von 1518
Die Tanzwut oder Tanzpest – Ein Zauber, der noch heute als Epidemie oder Pest dargestellt werden möchte… doch was waren die wahren Ursachen?
Es war das späte Mittelalter, als es um die Flüsse Mosel, Maas und dem Rhein zu einer seltsamen Erscheinung kam: Die Menschen sahen sich einer Tanzwut (epilipsia saltatoria) gegenüber, sie tanzten plötzlich los, bis zur absoluten Erschöpfung. Einige starben sogar daran.
Noch heute ist das Phänomen der damaligen Tanzwut unter vielen Begriffen bekannt, wie beispielsweise die Tanzplage, Choeromanie oder Tanzkrankheit. Sie begann, als einige Menschen auf dem Marktplatz zu tanzen begannen. Sie tanzten stundenlang und jeder, der sie beobachtete, schloss sich dem Tanz an. Nachdem sie sich den Tänzern angeschlossen hatten, konnten sie einfach nicht mehr aufhören. Manche tanzten Tage, bis sie zusammenbrachen und starben.
Die erste und letzte Tanzplage
Die erste Tanzwut tauchte laut Aufzeichnungen im Jahre 1374 in Belgien am Oberrhein auf. Weitere Tanzwutanfälle waren im Jahre 1463 im Eifelgebiet und 1518 in Straßburg zu beobachten.
Die besseren Aufzeichnungen betreffen Straßburg, als eine Frau namens Madame Troffea auf den Marktplatz trat und ganz unvermittelt zu tanzen begann. Diese Dame war in der Stadt sehr bekannt. Man sagte ihr nach, sie sei ein hübsches Wesen gewesen, aber auch dickköpfig und stets zu kleinen gemeinen Scherzen aufgelegt gewesen. Sie war die Erste, die einen endlosen Tanz aufführte, dem sich tagtäglich immer mehr Menschen anschlossen. Wie eine Plage griff diese Tanzwut auf immer mehr Menschen über, bis es nach Wochen viele hunderte Menschen waren, die auf Plätzen, Straßen und Gassen umhertanzten und nicht mehr aufhören konnten.
Die meisten hörten erst dann auf, als sie völlig erschöpft zusammenbrachen oder in Ohnmacht fielen. Einige unter ihnen fanden in ihrer Tanzwut sogar den Tod. Für die damalige Regierung war dies ein völliges Mysterium, das sie sich nicht erklären konnte und überlegten sich Maßnahmen, wie man diese Tanzwut stoppen könne. Der damalige Bürgermeister riet daher, neben den Tänzern eine Bühne aufzustellen und eine Band spielen zu lassen. Er erhoffte sich dadurch, dass dieses Bild der vielen Tänzer nicht mehr so beängstigend aussah und hoffte, die Musik würde die Tänzer auch beruhigen. Doch das Gegenteil trat ein. Immer mehr Menschen schlossen sich dem Tanz an.
Eine Elsässische Chronik berichtet
Eine Elsässische Chronik berichtet: „Viel hundert fingen zu Straßburg an, zu tanzen und zu springen, Frau und Mann, Am offenen Markt, Gassen und Straßen, Tag und Nacht ihrer viel nicht assen, Bis ihn‘ das Wüthen wieder gelag. St. Veits Tanz ward genannt die Plag.“
Als der Bürgermeisterrat erkannte, dass dies eher das Gegenteil bewirkt hatte, kamen sie auf die Idee, die Tänzer zu einer heiligen Kapelle zu locken, denn es könnten Dämonen dahinterstecken, die diese Tanzwut ausgelöst hatten. Sobald die Tänzer mit der heiligen Energie der Kapelle in Kontakt kämen, könnten sich die Dämonen entfernen wollen und die Tanzwut beenden. Tatsächlich, als die Tänzer zur Kapelle gelockt wurden und sie sich in einem bestimmten Abstand näherten, kamen die Tänzer wieder zu sich und hörten auf, den endlosen Tanz zu zelebrieren. In der Chronik dieser Zeit stand dazu:
„An den Schuhen war unten und oben ein Creutz mit Balsam aus Salböl gemacht und mit Weywasser besprengt in St. Veits Namen, da halff ihn vast allen.“
Tanzwut und ihre Erklärungen
Noch heute sind Medizin und Wissenschaft ratlos, wie eine solche Tanzwut entstehen konnte. Es gibt hierzu auch heute keine plausiblen wissenschaftlichen Erklärungen. Die meisten konnten sich dann darauf einigen, dass es vielleicht, wie soll es anders sein, ein Virus oder ein Parasit gewesen sein könne, der die Menschen zum endlosen Tanz animiert haben könnte. Auch zogen sie die Schwarze Pest heran, die es im Mittelalter gegeben haben soll und erklären, dass die Tanzwut vielleicht eine Art Ausklang der Pest gewesen war. Eine Vermutung nach der anderen, die nicht auf klare Analysen beruht, sondern nur der Meinungsbildung unserer Zeit dient, um die Existenz von „natürlichen“ Pandemien oder Epidemien zu rechtfertigen.
Einige der damaligen Ärzte, die mehr wissenschaftlich orientiert waren, gingen von einer Art sexuellen Krankheit aus, die durch Erregung und Ekstase auf andere Menschen übergriff. Sie benannten dieses Phänomen dann nicht als Tanzwut, sondern als laszive Choreographie (chorea lasciva). Wieder andere glaubten, es könnte das Mutterkorn gewesen sei, das in Hungerszeiten in Notfällen gern mal gegessen wurde. LSD basiert beispielsweise auf Mutterkorn und dessen chemische Zusammensetzung, aber vielleicht waren es auch Spinnen, die zu dieser Zeit Menschen gebissen haben könnten. Man kennt vielleicht den alten Spruch: „Sie sprang auf wie von der Tarantel gestochen“, dieser soll aus den Zeiten der Tanzwut stammen.
Man sieht, der Erklärungen gab es damals und heute viele. Im Mittelalter suchte man noch mehr nach der wirklichen Ursache, heutzutage werden Ursachen von der Wissenschaft kreiert, um neue Produkte zu verkaufen oder Impfungen an Mann und Frau zu bringen.
Die wohl beste Ursache für die Tanzwut
Sehr interessant sind auch die damaligen spirituellen Deutungen dieser Tanzwut. So wurde beispielsweise angenommen, dass die Tänzer innerlich die Hoffnung in sich trugen, sich dem Tanz anzuschließen, um Erleuchtung und eine höhere Ekstase zu erleben, um sich zu befreien und Zugang zu höheren Sphären zu erhalten – sozusagen als Ersatz für die Einnahme von bewusstseinserweiternden Substanzen; beispielsweise auch Hexenkräuter wie Tollkirsche, Bilsenkraut und Schierling.
Zu dieser Zeit gab es keine Drogenverbote, auch nicht für die so genannten Hexenkräuter, die selbst heute noch erlaubt sind und nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, da ihre Vorkommen so selten sind. Hexenkräuter wie Tollkirsche, Stechapfel, Schierling oder Bilsenkraut u.a. wurden einige hundert Jahre später zwar als Heilkräuter angesehen, aber durch die Medizin zunehmend verteufelt. Herangezogen wurden Kinder, die Gefahr liefen, die süßen giftigen Tollkirschen zu futtern und mit derartiger Propaganda schaffte es die Medizin, dass Hexenkräuter zunehmend vernichtet wurden, sobald man sie entdeckte. Heutzutage findet man derlei Kräuter kaum noch und sind höchstens in einem Botanischen Garten zu bewundern.
Kräuter wie Bilsenkraut und Stechapfel
Im Mittelalter mischte man in England beispielsweise gern Bilsenkraut ins Bier, um damit andere Pubs auszustechen. Es berauscht und man empfindet weniger Hemmungen und löste den Wunsch nach mehr aus. Einige Menschen, die sich mit diesen Kräutern auskannten, nahmen diese zu sich, um eine Verbindung zu ihrem höheren Sein zu finden und einen Zugang zu einer höheren Sphäre zu erlangen. Somit ist es allzu wahrscheinlich, dass zu jener Zeit eher solche natürlichen Hilfsmittel angewandt wurden, um eine persönliche Ekstase zu empfinden.
Da zur heutigen Zeit sämtliche Drogen verboten worden sind, die derartiges auslösen könnten und nur Substanzen hergestellt und in die Nahrung eingemischt werden, um die Menschen in dem Bewusstseinszustand zu halten, der vielmehr gefügig und weniger intuitiv macht, ist ein Austreten aus diesem Zustand nicht gern gesehen und zumeist gesetzlich untersagt.
Die Tanzwut findet sich heutzutage nur noch in alten Geschichten. Sogar eine Band, die mittelalterliche Musik praktiziert, nennt sich Tanzwut und ist auf Mittelaltermärkten manchmal anzutreffen.
Quellen:
„The Dancing Plague. A Public Health Conundrum“, Donaldson, LJ, in: Public Health 111 (1997), S. 201-204
„Vom „Enthusiasmus“ zur „Tanzwut“. Die Rezeption der platonischen „Mania“ in der mittelalterlichen Medizin“, Rohmann, Gregor in: Jahrbuch Tanzforschung 21 (2011), S. 46-61
„Tanzwut. Kosmos, Kirche und Mensch in der Bedeutungsgeschichte eines mittelalterlichen Krankheitskonzepts“, Rohmann, Gregor, Göttingen 2012.
„A Time to Dance, A Time to Die“, Waller, John, The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518, Thriplow 2008
Geschichten in Kurz Blog
Tanzwut Band